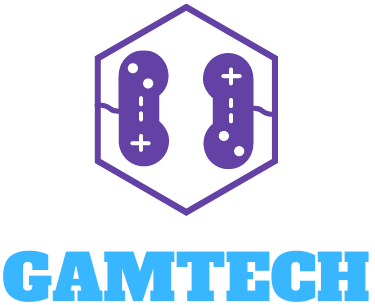Killerspiele und Zeiträuber, die Vorurteile gegen Videospiele halten sich hartnäckig. Trotzdem : Immer mehr Menschen spielen an Konsolen und PCs, vor allem auch Erwachsene – im Durchschnitt ist der österreichische « Gamer » 33,1 Jahre alt. Das Medium fasziniert. Wer es nicht glauben will : Die Umsätze der Branche haben allein von 2019 auf 2020 um 12,3 Prozent zugelegt. Der Historiker und Politologe Eugen Pfister erklärt, warum es wichtig ist, die Spiele wissenschaftlich zu untersuchen, und wie es in Österreich darum steht.
« Wiener Zeitung »: Warum ist die Videospielforschung wichtig für die Gesellschaft?

Eugen Pfister : Videospiele sind nicht nur ein lustiges, exotisches Nebenfeld, sondern zentraler Ort unserer Kultur. Hier kommen wir in Kontakt mit gemeinsamen Werten und Tabus. Gemeinsam mit Comics, Serien, Romanen sind sie ein Ort, wo unsere Gesellschaft sich immer wieder darauf einigt, was die verbindenden Werte sind. Teilweise treffen wir in letzter Zeit immer wieder auf Unverständnis in der Öffentlichkeit, wie es zu bestimmten Phänomenen kommt, zum Beispiel, wieso Leute nicht mehr an die Demokratie glauben. Grund sind naturgemäß nicht die Computerspiele. Sie sind ein Ort der Kommunikation, wo wir diese neuen politischen Inhalte teilweise sogar früher als in anderen Ebenen wahrnehmen können.
Welche Themen dominieren in aktuellen Top-Videospielen?
Was aktuell zum Beispiel stärker wird, ist die Demokratie-Skepsis. Hier gibt es eine Art Normalisierung, dass man nicht mehr den Glauben hat an eine Demokratie – da geht es um alles, was so dazugehört, auch die Entscheidungsfindung, die immer ein bisschen länger braucht, wenn man auf Konsens aus ist. Diese Skepsis hat nicht ohne Grund ihre Entsprechungen in unserem politischen Klima. Man erkennt das in dystopischen Spielgeschichten. Ich habe mir konkret Zombie-Spiele angeschaut, wo immer wieder die gleiche Erzählung auftaucht. Und da geht es ganz klar um eine Delegitimierung von Herrschaft, weil in diesen Spielen immer davon ausgegangen wird, dass unsere demokratischen Regierungen und Bürokratien unfähig sind, mit so einer Gefahr umzugehen.
Zugleich merke ich aber auch, dass es Gegenstimmen gibt. Es gibt Versuche, die immer öfter einen Wert darauf legen, dass man die Stärke von Kooperation zeigt. Was im Zombie-Genre zum Beispiel auftaucht, ist, dass es nicht mehr nur darum geht, dass man allein überlebt und niemandem vertraut, sondern dass man kleine Communitys wiederaufbaut. Diese Reibung zwischen dem Glauben an eine Demokratie und konsensbasierte, gemeinsame Entscheidungen auf der einen Seite und dem Individuum auf der anderen Seite. Das sind Gegenpole, die in politischen Ideen immer wieder auftauchen. Das merkt man jetzt wieder verstärkt und sieht es auch an politischen Entwicklungen.
Wie sieht die Game-Studies-Szene in Österreich aus?

Es gibt sehr kluge und spannende Kollegen und Kolleginnen. Aber Österreich ist wieder einmal in der Forschungslandschaft nicht so mutig wie andere Länder und derzeit hinten nach. In Graz gibt es ein Hub und in Klagenfurt auch. Ebenso an der Donau Universität Krems und der Universität für Angewandte Kunst. Es gibt kein Institut. Dabei sind die meisten Kollegen sehr an dem Thema interessiert. Aber die Strukturen lassen eine kontinuierliche Grundlagenforschung derzeit nicht zu. Ich bin aber vorsichtig optimistisch, dass es langfristig kommen wird, weil es kommen muss. Genauso wie die Filmwissenschaften gekommen sind.
Und im gesamten deutschsprachigen Raum?
En effet, dass lustigerweise überhaupt der deutschsprachige Raum hinterherhinkt. In Deutschland entsteht jetzt gerade einiges in Richtung kulturwissenschaftliche oder geisteswissenschaftliche Erforschung, kommt erst wirklich in den letzten drei, vier, fünf Jahren etwas. Die gute Nachricht ist, dass die Szene extrem engagiert ist. Wir haben vor einigen Jahren den Arbeitskreis Geschichtswissenschaft und Digitale Spiele gegründet, wo wir mittlerweile über 200 Mitglieder sind. Das machen wir auch in unserer Freizeit. Hier schreiben wir Blogs, machen Podcasts, hier vernetzen wir uns, hier organisieren wir Konferenzen und Workshops.
Das finde ich schön, weil es das Gegenteil vom Elfenbeinturm ist – weil wir alle keinen Sitz im Elfenbeinturm haben, ist auch der Kontakt zu denen, die unsere Texte lesen und unsere Videos schauen, extrem eng.
Wie sieht die Forscher-Community der Game Studies aus ?
Sie sind sehr jung, sie sind sehr engagiert. Quasi alle leben in prekären Arbeitsverhältnissen. Ich kenne zwei aus dem engsten Kreis, die entfristet sind, und beim ganzen Rest es so wie beim mir : von Projekt zu Projekt, von Stelle zu Stelle. Noch herrscht ein sehr starker Männerüberhang, wenn man sich die Aufteilung nach Geschlecht anschaut. Aber daran arbeiten wir gemeinsam. Da kommt es zum Glück zu einer Normalisierung, weil wir da auch sehr motivierte Wissenschafterinnen haben. Es wird jedes Jahr ein bisschen mehr. Trotzdem sind es gerade erst ein Viertel bis ein Drittel Frauen.
Wie ernst wird die Videospielforschung in der Wissenschaft genommen ?
Mittlerweile sehr ernst. Vor einigen Jahren tat ich mir noch schwer zu erklären : « Ich analysiere Computerspiele. » Das Problem habe ich jetzt nicht mehr seit vier Jahren. Nicht nur ich, sondern auch Kollegen, werden regelmäßig von unterschiedlichen Instituten zu Vorträgen eingeladen. Im November bin ich zum Beispiel von der französischen Nationalbibliothek eingeladen, einen Vortrag zu moderieren.